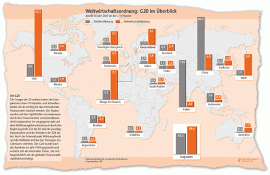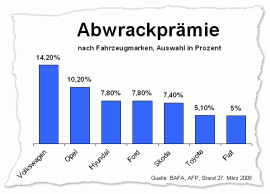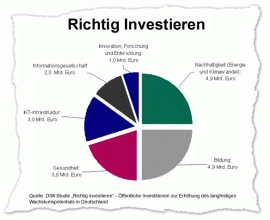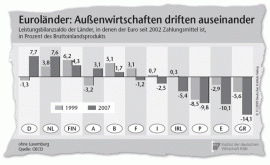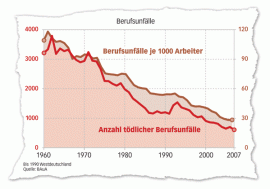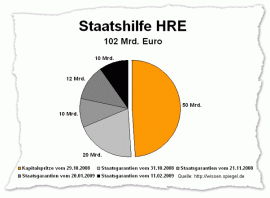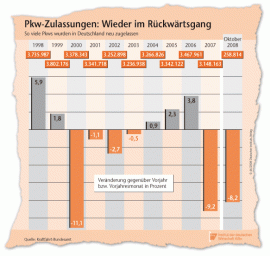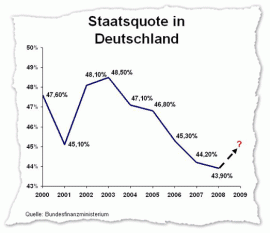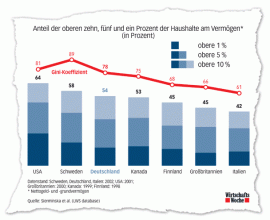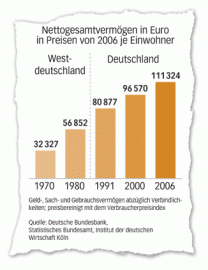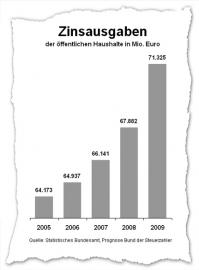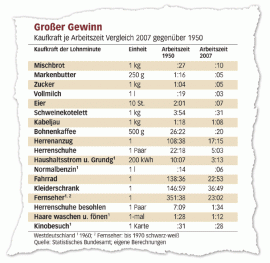Was die Staats- und Regierungschefs gestern in London auf den Weg gebracht haben, kann sich sehen lassen. Immerhin hatten sie nicht weniger als eine historische Herkulesaufgabe zu meistern. Die Finanzkrise hat aufgezeigt, an welcher Stelle die Märkte an ihre Grenzen stoßen, wenn die Rahmenbedingungen falsch gesetzt sind: Zu niedrige Zinsen, faule Kredite, Haftungs- und Regulierungslücken, zu laxe Bilanzierungsregeln und eine mangelhafte internationale Koordination. Auf diesen Baustellen hat der G20-Gipfel jetzt das Fundament für eine neue, zeitgemäße Weltfinanzordnung gegossen.
Wer hätte noch vor einem guten halben Jahr gedacht, dass Reformen möglich werden, an denen sich manche Regierungen wie die deutsche jahrelang die Zähne ausgebissen haben. Jetzt sollen alle wichtigen Finanzinstitutionen stärker reguliert und beaufsichtigt werden. Dazu gehören auch die Hedgefonds, deren Kontrolle bis gestern am Widerstand der USA und Großbritanniens gescheitert war. Auch beim Thema Steueroasen ging es jahrelang nur in kleinen Trippelschritten vorwärts. Jetzt hat man endlich einen großen Satz gemacht, selbst wenn hier auf Dauer noch mehr nötig ist. Mit der Aufwertung des Financial Stability Forums zum neuen Financial Stability Board wird eine hoffentlich schlagkräftigere internationale Finanzaufsichtsbehörde geschaffen. Der Internationale Währungsfonds wird durch die Aufstockung seiner Finanzmittel handlungsfähiger gemacht, und es wird eine grundlegende Reform angemahnt. Bahnbrechend ist, dass der IWF-Direktor in Zukunft nicht mehr automatisch allein von den Europäern bestimmt werden kann, sondern nach Qualifikation ausgewählt wird.
Mit den Ergebnissen des Gipfels steht das Fundament, bis zum Richtfest werden die einzelnen Nationalstaaten aber noch Sonderschichten einlegen müssen: Jetzt geht es darum, die Absichtserklärungen von London in nationales und europäisches Recht umzusetzen. Dabei darf staatliche Kontrolle und Regulierung aber nicht zu einer Belastung für ein freies, marktwirtschaftliches Finanzsystem werden. Denn bei einer schrägen Statik, gerät auch die neue Finanzarchitektur wieder ins wanken.
Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln kommentiert den G20-Gipfel heute im Handelsblatt. Prof. Dr. Michael Hüther sieht die größten Aufgaben jetzt in der Verantwortung der Nationalstaaten: „Die Bankenaufsicht muss gestärkt werden und die Bad-Bank Frage muss beantwortet werden. Bei beiden Themen hat die Bundesregierung noch reichliche Hausaufgaben zu erledigen.“