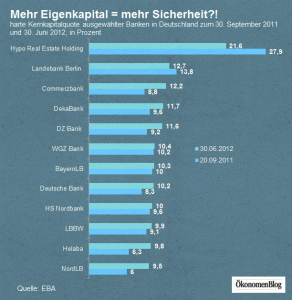Ob Konjunktur-, Banken- oder Finanzkrisen: Neben der Vernichtung von Werten haben Krisen immer auch etwas Positives. Schonungslos legen sie offen, welche Produkte nicht mehr genügend Nachfrage finden und welche Unternehmen nicht mehr im Wettbewerb mithalten können. Schöpferische Zerstörung – so bezeichnete der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter diesen Prozess. Auch für Regulierungsvorschriften lassen sich Erkenntnisse ableiten.
Die Bankenkrise hat uns gezeigt, dass allein mehr Regulierungsvorschriften nicht zu einem stabileren Bankensektor führen. Die Bankenaufsicht wurde seit 1988 kontinuierlich weiterentwickelt. Zwischen den Jahren 1968 und 1988 wuchsen die Personalausgaben der Aufsichtsbehörden (ohne Bundesbank) in etwa mit der Rate des gesamten Kreditsektors. Ab 1988 sind sie etwa drei Mal so schnell gewachsen. Eine ähnliche Expansion findet sich auch in den USA oder Großbritannien. Das Regelwerk von Basel I umfasste noch 30 Seiten. Für Basel II hingegen waren schon 300 notwendig. Und obwohl die Dokumentation von Basel III nur punktuelle Vorschläge enthält, umfasst dieses Werk bereits 600 Seiten.
Somit spricht wenig dafür, dass wir vor der Krise zu wenig reguliert hätten. Plausibler ist die Vermutung, dass die Regeln schlichtweg falsch waren.
Relevant für die Aufsicht ist die Eigenkapitalquote (Tier-1-Ratio) der Banken. Neueste Untersuchungen zeigen aber, dass dies ein eher schlechter Indikator für die Pleitewahrscheinlichkeit einer Bank ist. Länder, deren Banken eine höhere Kernkapitalquote aufwiesen, waren nicht weniger stark von der Krise betroffen. Interessant ist auch, dass Institute sich 2012 zu einem großen Teil durch Veränderungen der internen Risikomodelle und durch Ausnutzung von Bilanzierungsspielräumen rekapitalisierten. Nur etwa die Hälfte des 2012 auf Druck der EBA (European Banking Authority) aufgebrachten Eigenkapitals stammt aus „echten“ Kapitalerhöhungen. Viel spricht also dafür, dass es sich bei der gewichteten Eigenkapitalquote im Krisenfall um eine eher flüchtige Größe handelt.
Darauf gibt es grundsätzlich drei Antworten:
- Man kann versuchen durch noch mehr Regeln und Überwachung die Risikomodelle zu verbessern.
- Man könnte die Eigenkapitalquoten auf ein Niveau heben, bei der die Angemessenheit der Risikomodelle kaum noch ins Gewicht fällt.
- Man trennt riskante Bankgeschäfte von den restlichen Geschäften ab, statt auf Eigenkapitalunterlegung zu bauen. Damit verließe man das brüchige Fundament der Risikomodelle (Liikanen-Report).
Antwort 1 wird zunehmend in Frage gestellt. Wie Antwort 2 und 3 zu beurteilen sind, darüber kann man streiten. Viel spricht dafür, dass der Liikanen-Ansatz in die richtige Richtung geht (Antwort 3). Im Mittelpunkt des Modells steht die Vorstellung, das traditionelle Bankengeschäft vom Handelsgeschäft zu trennen ohne aber Universalbanken zu zerschlagen. Risiken werden so aus dem Bankensystem ausgelagert.
Sicher ist hingegen, dass die gleichzeitige Verwirklichung aller drei oben genannten Regulierungsansätze kostspielig und inkonsistent ist und am Ende ein Aufsichtssystem schafft, was durch seine Komplexität nicht mehr zu beherrschen sein wird. Wir laufen Gefahr den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.