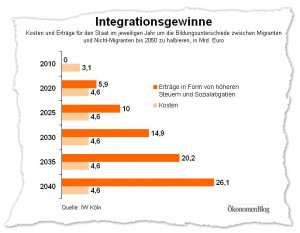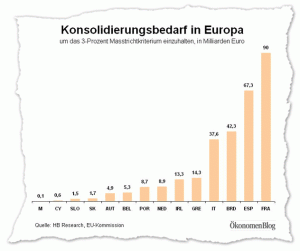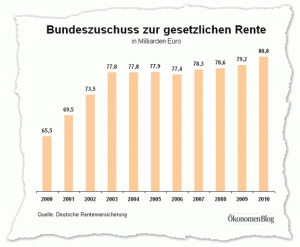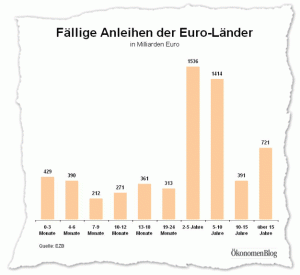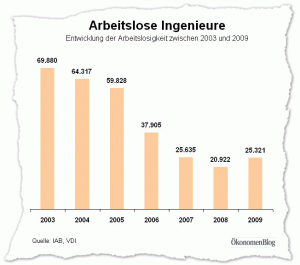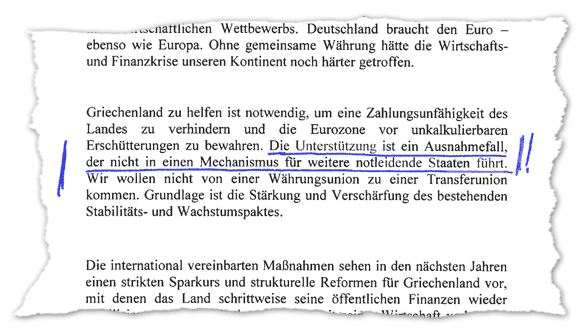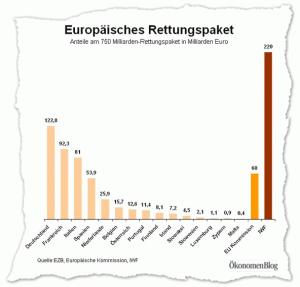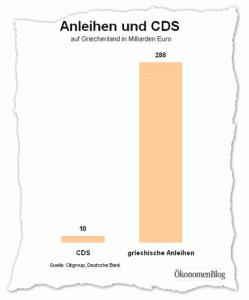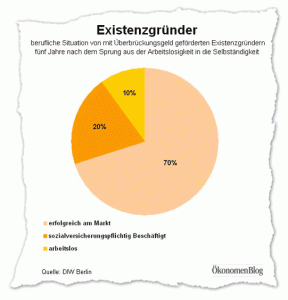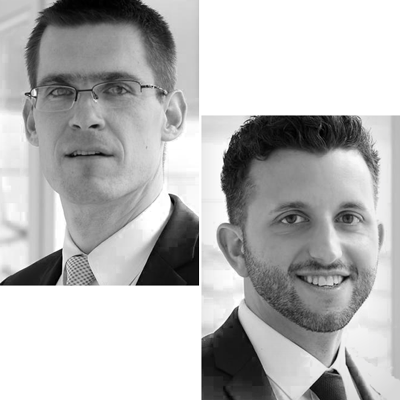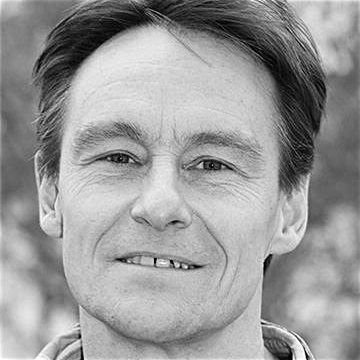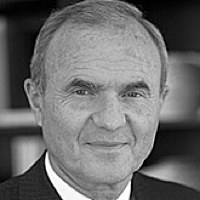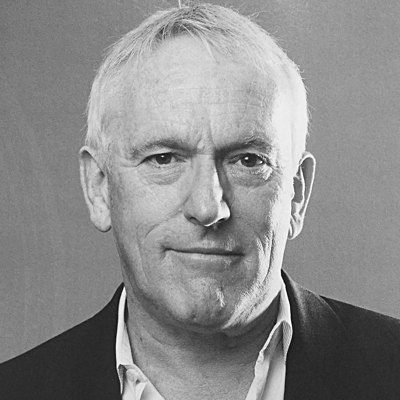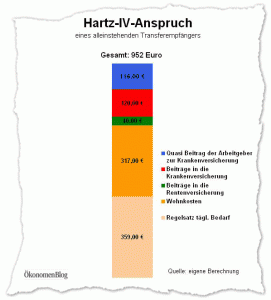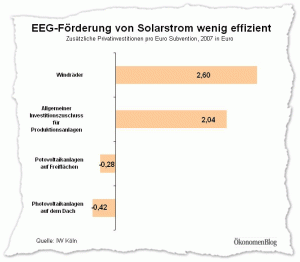Die EU spannt einen in der Geschichte einmaligen Rettungsschrim auf. Für klamme Mitgliedsstaaten wurde ein 750 Milliarden schwerer Rettungsfonds eingerichtet. Dabei kommen 440 Milliarden in Form von Garantien und Krediten von den Mitgliedsstaaten, 60 Milliarden stellt die europäische Kommission bereit und 250 Milliarden stammen aus dem Topf des IWF. Darüber hinaus hat die EZB mit dem Aufkauf von Staatsanleihen begonnen und finanziert somit faktisch Staatsdefizite mit der Notenpresse.
Der Chef der deutschen Bundesbank, Prof. Axel Weber, äußert sich gegenüber der Börsenzeitung skeptisch. Der Ankauf von Staatsanleihen berge
“erhebliche Stabilitätspolitische Risiken.”
Die Ankäufe sollten deswegen streng begrenzt werden.
“Sie zielen allein darauf ab, die Funktionsfähigkeit der Anleihemärkte und des geldpolitischen Transmissionsprozesses wiederherzustellen.”
Prof. Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchener IFO Instituts, sieht darin nicht unbedingt Inflationsrisiken. Vielmehr sieht er das Geld der deutschen Steuerzahler bedroht.
„Es droht aber ein Verlust mit den griechischen Anleihen. Für die Verluste der EZB kommt in erster Linie der deutsche Steuerzahler auf“
sagte er gegenüber der FAZ.
Prof. Clemens Fuest, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats beim Finanzministerium, sieht das anders. Inflation droht nicht in der kurzen Frist,
„aber langfristig auf jeden Fall. Deshalb darf der Ankauf von Staatsanleihen nur eine vorübergehende Maßnahme sein.“
Weitestgehend einig ist man sich darüber, ob das Rettungspaket den griechischen Staatsbankrott vermeiden kann. Prof. Sinn geht trotz Rettungspaket von einer Insolvenz Griechenlands aus:
“Es ist nicht abzusehen, dass Griechenland in der Lage sein wird, seine Schulden zurückzuzahlen. Die 110 Milliarden Euro über drei Jahre, die Griechenland zur Verfügung gestellt werden, dienen dazu, die privaten Gläubiger, gegen staatliche Gläubiger auszutauschen.“
Auch Prof. Fuest rechnet nicht mit einer Rettung:
„Ich rechne damit, dass Griechenland seine Schulden nicht zurückzahlen kann.“
Gegenüber dem Focus sagt Hans-Peter Burghof, Professor für Finanzdienstleistungen an der Universität Hohnheim:
„Die Aufgabe der EZB ist es, Europa vor einer Inflation zu schützen. Ich bin nicht sicher, ob sie das jetzt noch kann. Ihre Unabhängigkeit ist bedroht.“
Als letzten Ausweg aus der Krise sieht Burghof nur die Haushaltskonsolidierung:
„Es geht nichts an einer Haushaltskonsolidierung vorbei. Die südlichen EU-Länder müssen ihre Ausgaben zurückfahren, auch wenn das erst mal wehtut und womöglich die Konjunktur dämpft. Das Problem ist: Ihnen fehlt der Anreiz, zu sparen. Ihre Fehler werden schließlich sozialisiert: Die anderen EU-Länder zahlen.“
ÖkonomenBlog zur Griechenlandkrise
Nein – weil´s nicht hilft – von Frank Schäffler, MdB
Rosskur für Griechenland – von Prof. Dr. Michael Hüther
Griechenland sollte Währungsunion verlassen – von Prof. Dr. Rolf Peffekoven
Axt an Wurzeln des Wohlstandes – von Prof. Dr. Andreas Freytag
EZB: Unabhängigkeit in Gefahr – von Marc Feist
Griechensoli mehr als fragwürdig – von Prof. Dr. Michael Hüther
Darf´s ein bisschen mehr sein? – von Marco Mendorf
Stabilität des Euros gefährdet? – von Prof. Dr. Renate Ohr
Und tschüs – von Frank Schäffler
Griechische Naturkatastrophe – von Prof. Dr. Andreas Freytag
Starker Euro – nur ohne Griechen-Hilfe – von Frank Schäffler, MdB
Dossier zur Finanzkrise in Griechenland auf INSM.de