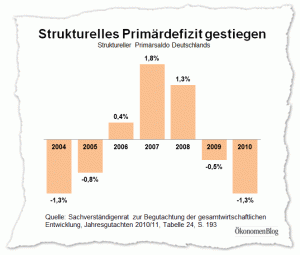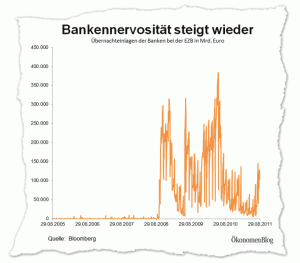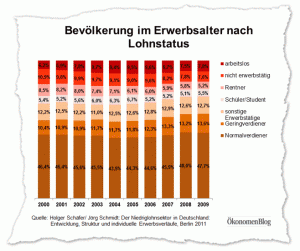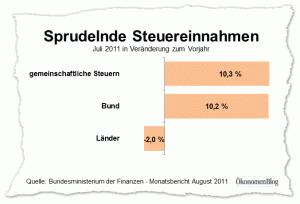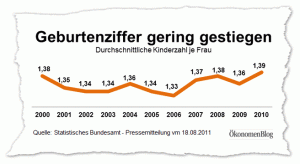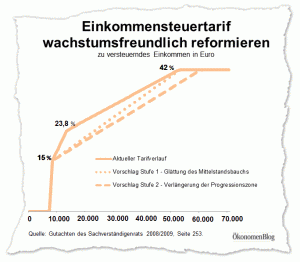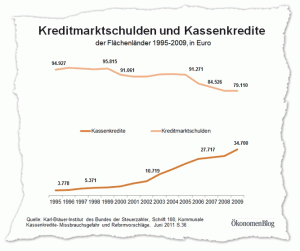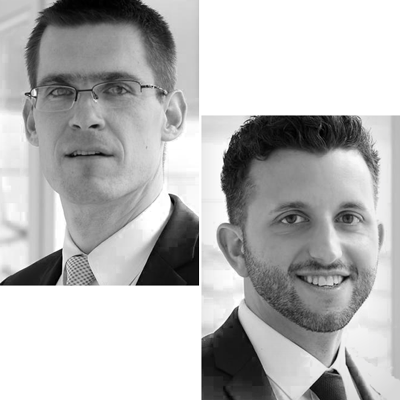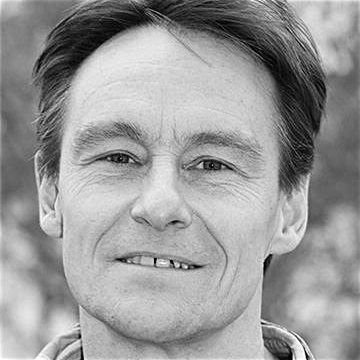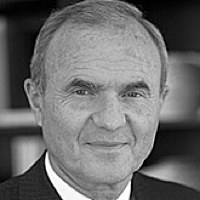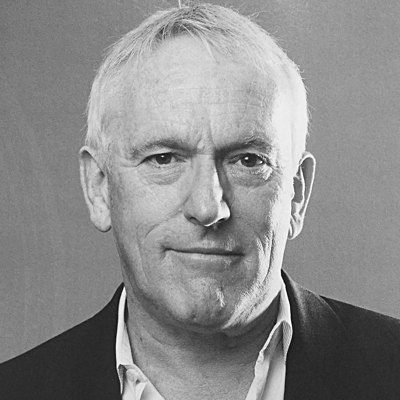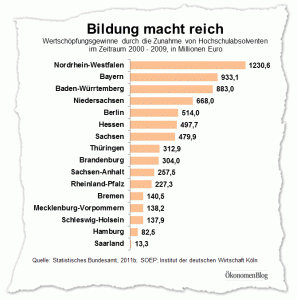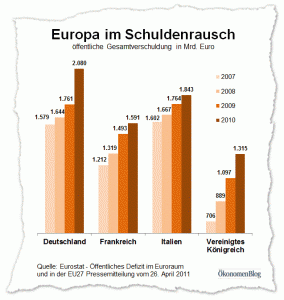Buchkritik: Gordon Brown: Was folgt – wie wir weltweit neues Wachstum schaffen, Frankfurt am Main 2011
Sein Buch hätte als eine der elegantesten Bewerbungsschreiben der Geschichte für den Chefposten des IWF eingehen können. Schließlich war der Job vor wenigen Wochen kurzfristig frei geworden. Doch bekanntermaßen kam Gordon Brown eine gewisse Französin zuvor. „Was folgt – wie wir weltweit neues Wachstum schaffen“ des britischen Ex-Premiers wagt den Rundumschlag für die Erneuerung der Weltwirtschaft – gut und verständlich geschrieben, anregend, anekdotisch und durchaus selbstkritisch. Schade nur, dass seine Überlegungen zu oft nur als Arbeitsthesen formuliert sind und dadurch recht akademisch wirken.
Brown ist überzeugt, dass es den Volkswirtschaften nur durch globale Kooperation und Koordination gelingen wird, in den nächsten Jahren ein Wachstumsniveau zu erreichen, das die heutigen Annahmen übertrifft. Die Zeit der Alleingänge sei vorbei. Es gelte einen weltweit verbindlichen, neuen Mechanismus zur Krisenprävention zu entwickeln, um die Ungleichgewichte infolge globaler Kapitalströme in Angriff nehmen. Ein solches Instrument müsse eine aktive und transparente Überwachung ermöglichen. So könnten beispielsweise „Country Clubs“, moderne Investorennetze, in denen Gläubiger und Länder in einen offenen Dialog treten, für größere Transparenz und Kontrolle sorgen.
Grundsätzlich sind die Weltwirtschaftsprobleme für Brown struktureller Natur – der Konsum muss angekurbelt werden, die Verbraucherausgaben zurückgehen. Eine Wiederkehr des hohen globalen Nachfrageniveaus ist für ihn ohne globalen Wachstumsplan nicht möglich. Brown listet vor allem den USA und den Bric-Staaten Hausaufgaben auf: Die Amerikaner müssen die Chancengleichheit für ihre Bevölkerung erhöhen und stärker in Aus- und Weiterbildung investieren. China soll soziale Absicherung seiner Arbeiter bezahlbarer und Wohnen für die Menschen billiger machen. Zudem soll das Land die Kreditvergabepraktiken seiner Banken reformieren und der ganzen Welt seinen Markt für Finanzdienstleistungen öffnen.
Indien und die asiatischen Volkswirtschaften müssen mehr in den Ausbau ihrer Infrastruktursysteme investieren, die Qualität von Bildung und Qualifikationen steigern und Schulden und Defizite besser kontrollieren. Russlands Zweiklassengesellschaft mit finanziell starkem staatlichen und schwachen privatem Sektor kann nur durch Diversifizierung weg von Öl und Gas und durch ein Wirtschaftsreformprogramm auf ein nachhaltiges höheres Wachstumsniveau hoffen, das unabhängig von volatilen Rohstoffen ist. Brasilien schließlich gibt der Autor den Rat, mehr im Ausland zu investieren als ständig die Ersparnisse oder den Verbrauch im eigenen Land zu erhöhen.
Ausschlaggebend ist für Brown, Sohn eines schottischen Pastors, letztlich die soziale Komponente. Soziale und wirtschaftliche Fragen seien untrennbar verbunden. „Im 21. Jahrhundert brauchen Markt und Staat die Unterstützung von ethischen Standards“, schreibt er. Brown meint damit den Dritten Weg, mit dem er und Tony Blair Anfang der 90er angetreten waren. Und mit dem sie knapp zwanzig Jahre später auch nicht einen der größten Bankenzusammenbrüche der Geschichte verhindern konnten.