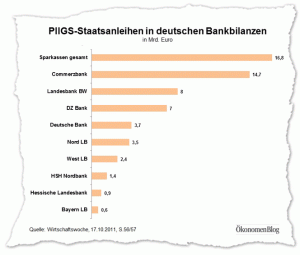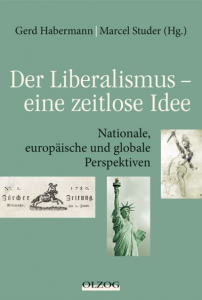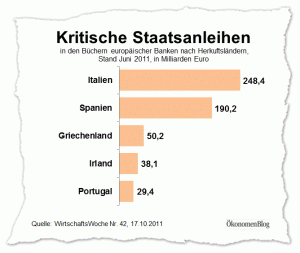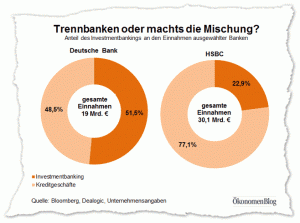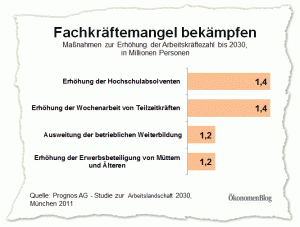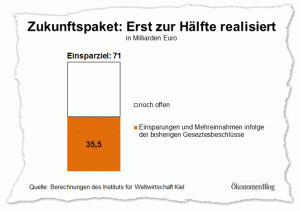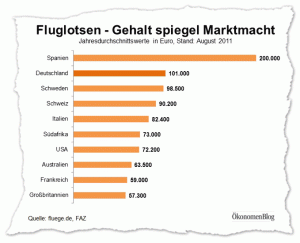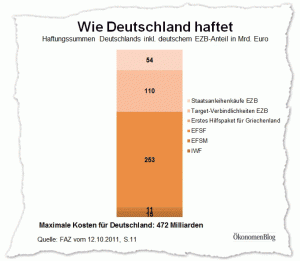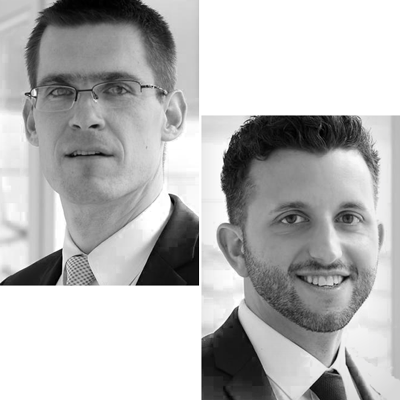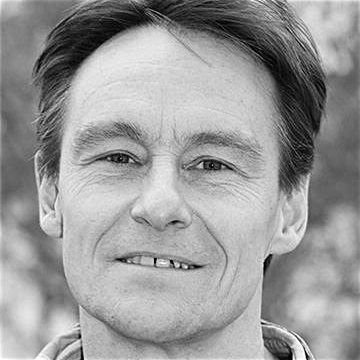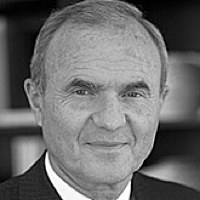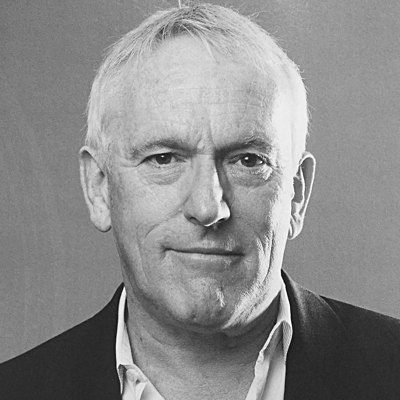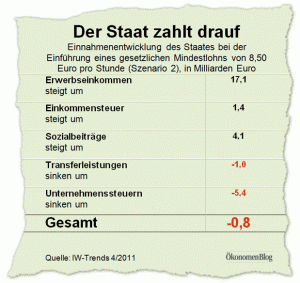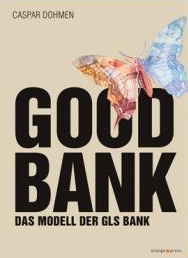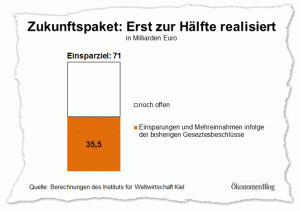
Jahrzehntelang herrschte in Deutschland die Praxis vor: Ob die Konjunktur lahmte oder brummte, ohne Neuverschuldung ging es nicht. Mit der Einführung der Schuldenbremse wurde ein konkreter Weg zu einer soliden Haushaltsführung festgeschrieben. Ab dem Jahr 2016 darf der Bund nur noch ein strukturelles Defizit aufweisen, das im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 0,35 Prozent beträgt. Die strukturelle Neuverschuldung muss bis dahin in gleichen Schritten abgebaut werden.
Im Sommer 2010 musste die Bundesregierung Farbe bekennen und schnürte ein „Zukunftspaket“. Es enthält für die Jahre 2011 bis 2014 etliche Einsparmaßnahmen, bescheidene Kürzungen der Steuervergünstigungen, aber auch kräftige Steuererhöhungen in Form neuer Steuern. Das Volumen für den gesamten Zeitraum beträgt knapp 80 Mrd. Euro, ohne die eingesparten Zinsausgaben knapp 75 Mrd. Euro. Dabei entlastet sich der Bund auch auf Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung. Für den Staat (in konsolidierter Betrachtung) umfasst das „Zukunftspaket“ rund 71 Mrd. Euro.
Teile des Pakets sind umgesetzt worden. Eine Luftverkehrsabgabe und eine Kernbrennstoffsteuer wurden eingeführt, Transfers wie das Elterngeld wurden etwas reduziert. In vielerlei Hinsicht ist das Paket aber aufgeschnürt und verwässert worden. Eine Finanzmarkttransaktionssteuer (6 Mrd. Euro) wurde nicht eingeführt, ist aber noch geplant. Die Kernbrennstoffsteuer wird wohl statt der erhofften 9,2 Mrd. nur 4 Mrd. Euro in die Kasse des Bundes spülen. Die Bundeswehrreform wird wesentlich geringere Einspareffekte haben als geplant (4 Mrd. Euro). Die Einsparmaßnahmen bei der Bundesagentur für Arbeit und beim Arbeitslosengeld II werden auch geringer als angestrebt ausfallen (20,5 Mrd. Euro). Bei den Personal- und Sachaufwendungen wird der angepeilte Einspareffekt ebenfalls nicht erreicht werden. Gegenwärtig sieht es so aus, als würden die öffentlichen Haushalte im Zeitraum 2011 bis 2014 durch das „Zukunftspaket“ um nur 37 Mrd. Euro entlastet. Es ist sogar geplant, das Weihnachtsgeld für Beamte des Bundes zu erhöhen, was 0,5 Mrd. Euro je Jahr kostet. Die gesamte Entlastung würde dann auf 35,5 Mrd. Euro schrumpfen und damit rund 50 Prozent des im Sommer 2010 angekündigten Entlastungsvolumens betragen.
Die Perspektiven für die Bundesfinanzen sind dennoch günstig. Das Steueraufkommen fällt seit Sommer 2010 wesentlich höher als damals erwartet. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich besser als antizipiert mit der Folge, dass die Ausgaben für das Arbeitslosengeld II und das Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit niedriger als geplant sind. Obendrein profitiert der Bund bei der Kreditaufnahme von extrem niedrigen Zinssätzen. Es gibt eine gute Chance, dass der Bund im Jahr 2016 der Vorgabe der Schuldenbremse gerecht werden wird.
Es gibt allerdings Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung, die insbesondere aus der Staatsschuldenkrise im Euroraum herrühren. Um diesen Risiken Rechnung zu tragen, sollte die Bundesregierung rasch ein Sparpaket vorlegen. Insbesondere sollten die Subventionen gekürzt werden. Ein konkretes Programm hat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Anfang des Jahres 2011 vorgestellt.