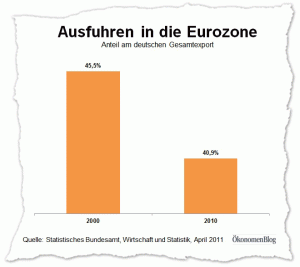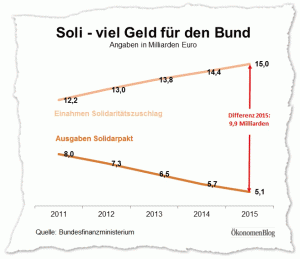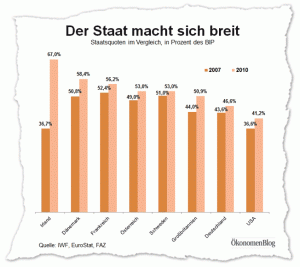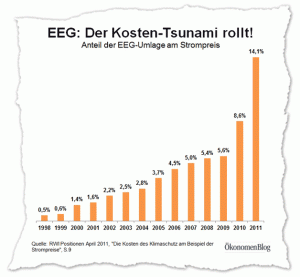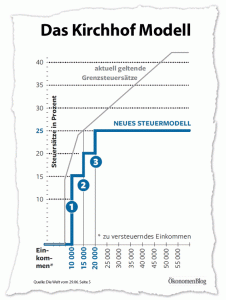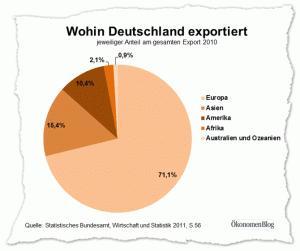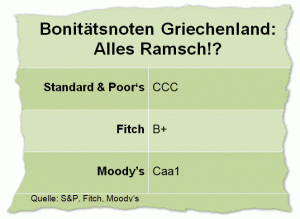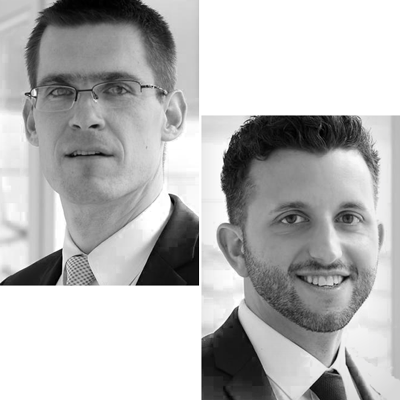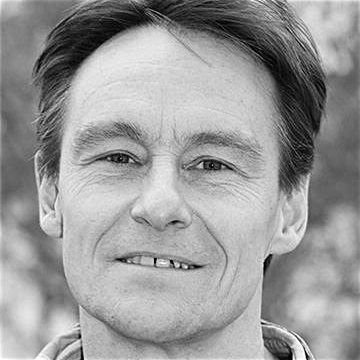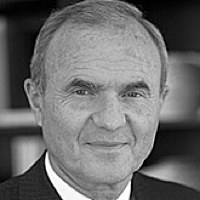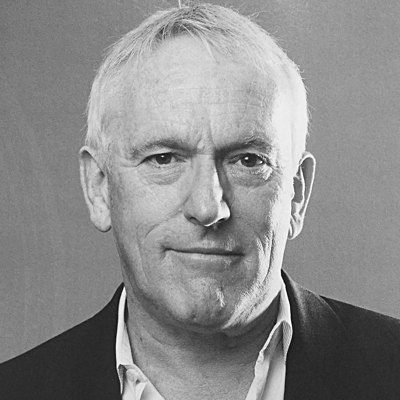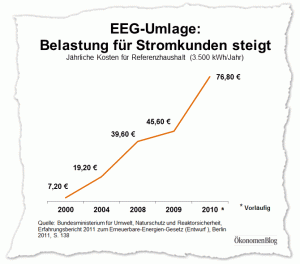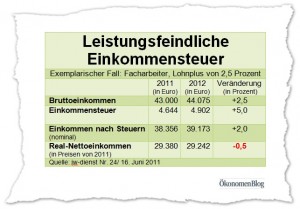Der Erfolg des Internets hat zwei Ursachen. Zum einen: seine universelle Struktur. „Die unterschiedlichsten Inhalte wie Schrift, Grafik, Musik, Fotos, Video, Businessanwendungen und Spiele werden in den gleichen Typ von Datenpaketen transformiert und in dieser Form über eine einzige Infrastruktur verschickt“, sagt zum Beispiel Jörn Kruse, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in Hamburg.
Der zweite Erfolgsfaktor: die Stückelung der Daten. Eine Word-Datei im Anhang einer E-Mail zum Beispiel wird nicht als gesamte Datei durch das Netz zum Empfänger geschickt, sondern in vielen kleinen Paketen, über unterschiedlichste Wege. Jedes Paket enthält im so genannten Header die Information über das Ziel und die Position im Datenstrom. Beim Empfänger dann werden die Pakete wieder zusammen gesetzt, zu einer Word-Datei zum Beispiel.
Bisher werden alle Datenpakete gleich behandelt. Kommt es wegen Datenüberlastung im Internet zum Stau, wird das erste Datenpaket, das am Stauende ankommt, auch vor den dahinter eintreffenden durch den Stau gelotst. Überholen verboten! In der Warenwirtschaft heißt dieses Prinzip „Fifo“, „First in, first out“, im Internet heißt es „Best Effort“.
Mit der Homogenität könnte es bald vorbei sein. Es gibt zahlreiche Bestrebungen, die Logik des Internets an einer zentralen Stelle zu verändern: In Zukunft sollen die einzelnen Pakete priorisiert werden können.
Eine Priorisierung der Datenpakete würde nun dazu führen, dass an Engpässen neu sortiert wird. Datenpakete mit einer hohen Priorisierung würden dann bevorzugt behandelt, jene mit einer niedrigen müssten länger warten.
Technisch wäre dies denkbar einfach umzusetzen: In dem schon heute vorhandenen so genannten Header jedes Datenpakets würde zusätzlich die Priorisierung aufgenommen.
Continue reading “Die Abkehr von der Netzneutralität würde die Qualität des Netzes verbessern”