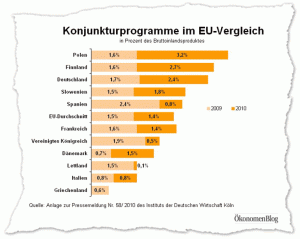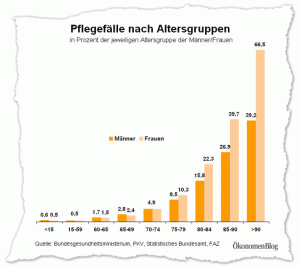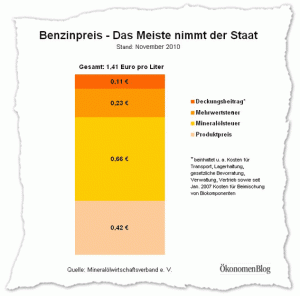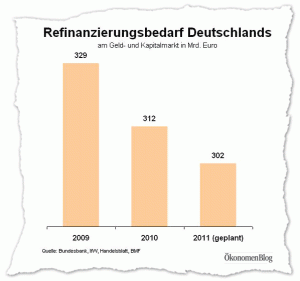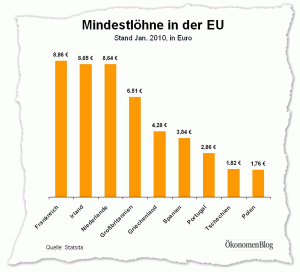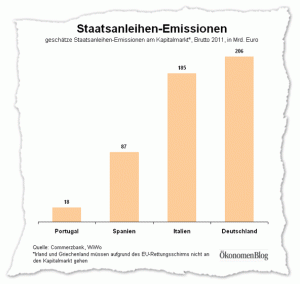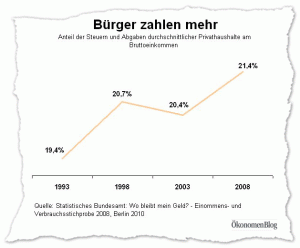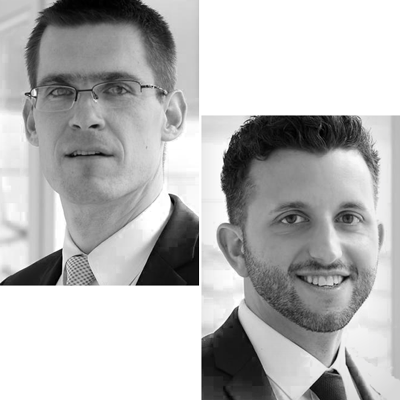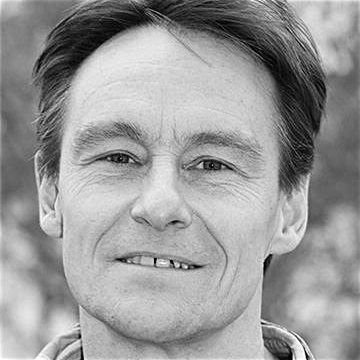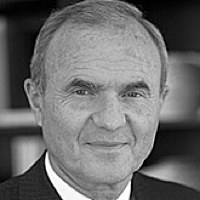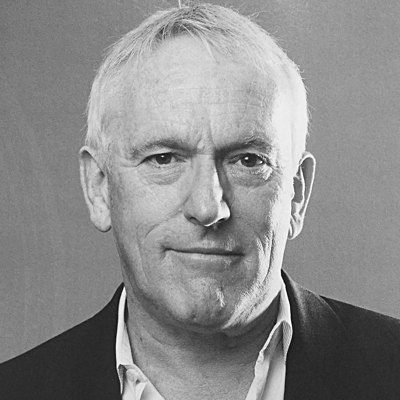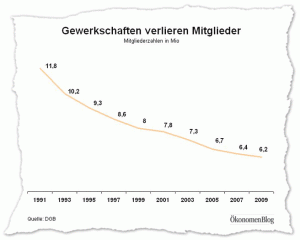Mit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise erlebten staatliche Konjunkturprogramme eine Renaissance. Und in vielen Ländern verfehlten sie ihre Wirkung nicht. Dies sollte aber nicht dazu führen, die grundsätzlichen Probleme solcher staatlicher Hilfen außer Acht zu lassen. Nicht zu Unrecht werden sie seit den 70er Jahren von den meisten Ökonomen sehr kritisch betrachtet. Denn damals galt der Grundsatz: Kaum schwächelte die Wirtschaft, schon wurde von zahlreichen Politiker und Ökonomen reflexartig nach staatlichen Hilfen gerufen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass hier im Regelfall mehr Schaden angerichtet wurde als zu einer nachhaltigen Lösung einer schwächelnden Wirtschaft beizutragen. Fakt ist: Ein dauerhaft höheres Wirtschaftswachstum ist mit den staatlichen Eingriffen nicht zu erreichen. Erfolgreich scheinen sie nur dann zu sein, wenn es zu einem plötzlichen, starken Einbruch der Nachfrage kommt.
Aber auch dann sich Konjunkturprogramme nicht unproblematisch. Sie müssen rechtzeitig in Kraft treten und zielgerichtet ausgestaltet sein. Wichtig auch: Sie müssen in zeitlich befristet sein, damit sie die öffentlichen Haushalte nicht dauerhaft belasten und somit die zukünftigen haushaltspolitischen Spielräume nicht zu sehr einengen. Schließlich muss auch der Grundsatz beachtet werden: Wer in der Krise die staatlichen Aktivitäten massiv ausweitet, muss diese später auch im gleichen Umfang wieder zurückfahren. 2009 und 2010 hat Deutschland 4,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Konjunkturprogramme ausgegeben. Damit war Deutschland im EU-Vergleich sehr ambitioniert. Folglich sind auch die Vorwürfe aus dem Ausland haltlos, Deutschland stütze die internationale Konjunktur zu wenig. Für 2011 gilt es nun mit dem Abbau der durch die Konjunkturprogramme entstandenen Staatschulden zu beginnen, um das künftige Wachstum nicht zu beeinträchtigen. Wünschenswert wäre es, wenn Deutschland nun auch hier im EU-Vergleich eine Vorreiterrolle spielen würde.
Die Langfassung dieses Beitrags ist als IW-Trends 4/2010 erschienen.